|
|
|
JUPITER
Jupiter / Einführung
Jupiter ist der Riese im Sonnensystem. Siebzig Prozent der Gesamtmasse aller
Planeten entfallen auf ihn. Zu erkennen ist für uns nur die dichte
Atmosphäre, deren Stärke acht Mal größer ist als die der Erde.
Weiter zum Kern vordringend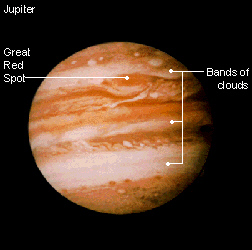 folgt eine Schicht mit flüssigem
Wasserstoff. Durch Kristallisation, eine Folge des enormen
Drucks, geht diese Schicht über
in metallischen Wasserstoff. Im
Zentrum befindet sich ein Gesteinskern mit einem Durchmesser von etwa 25000 Kilometern. Hier ist die Temperatur
mit 30 - 35000 Grad Celsius am
höchsten.
folgt eine Schicht mit flüssigem
Wasserstoff. Durch Kristallisation, eine Folge des enormen
Drucks, geht diese Schicht über
in metallischen Wasserstoff. Im
Zentrum befindet sich ein Gesteinskern mit einem Durchmesser von etwa 25000 Kilometern. Hier ist die Temperatur
mit 30 - 35000 Grad Celsius am
höchsten.
Nach außen nimmt die Hitze
stark ab. In den oberen Wolkenschichten schließlich ist es bis
Minus 150 Grad Celsius kalt.
Jupiter gibt das 1,7 fache der Energie ab, die er von der Sonne erhält. Der
Riesenplanet konnte sich aber nicht selbst zur Sonne weiterentwickeln. Trotz
seiner Größe mangelt es ihm ganz entschieden an Masse.
Jupiter ist nicht nur der größte, sondern auch der schnellste Planet. Für
eine Eigenrotation benötigt er weniger als zehn Stunden. Durch die hohe
Drehgeschwindigkeit werden die Wolkenstrukturen beeinflusst. Es entstehen
Wolkenbänder, die in Zonen um den Planeten kreisen. Man unterscheidet,
unterteilt nach Nord- und Südhalbkugel, etwa zehn Zonen (gemäßigte,
tropische und äquatoriale).
Die einzelnen Wolkenzonen rasen mit bis zu 500 Stundenkilometern in
entgegengesetzten Richtungen um Jupiter. Diese scheinen recht stabil und
langlebig zu sein. Seit genauere Beobachtungen möglich sind, also seit etwa
fünfzig Jahren, haben sich die Strukturen kaum verändert.
Die hohe Rotationsgeschwindigkeit sorgt letztlich auch dafür, dass Jupiter
ein ausgeprägtes Magnetfeld hat. Dessen Strahlungsausläufer erreichen sogar
die Bahn des Saturn.
Die Atmosphäre besteht zum größten Teil aus Wasserstoff und Helium. Daneben
sind auch Methan und Ammoniak und andere Bestandteile vorhanden.
Zu diesen anderen Bestandteilen zählt Phosphin (PH3), was einen typischen
Knoblauchgeruch verursacht. Für Vampire wäre Jupiter also auch nichts.
Ein besonderes Schauspiel bot sich den Astronomen im Juli 1994. Der Komet
Shoemaker-Levy-9 zerbrach in mehrere Fragmente. Diese stürzten auf den
Planeten. Die Helligkeit der gewaltigen Kollisionsexplosionen überschritt
die Helligkeit von Jupiter um das fünfzigfache.
Jupiterbahn
Jupiter benötigt für einen Sonnenumlauf ca. 11,86 Erdenjahre. Die mittlere
Sonnenentfernung beträgt 778 Millionen Kilometer. Seine Bahngeschwindigkeit liegt bei 13,05 Kilometern pro Sekunde.
Zum Vergleich, die Erde folgt ihrer Umlaufbahn mit einer
Geschwindigkeit von knapp
dreißig Kilometern pro Sekunde.
ihrer Umlaufbahn mit einer
Geschwindigkeit von knapp
dreißig Kilometern pro Sekunde.
Bei der Eigenrotation (eine
Umdrehung um die eigene
Achse=einTag) ist der Riese
deutlich schneller als die Erde,
ja schneller als alle anderen
Planeten. In seiner ständigen
Begleitung sind 16 Monde.
Während ein Sterntag bei uns
24 Stunden dauert, benötigt Jupiter lediglich neun Stunden
und 55 Minuten.
Das heißt, unter günstigsten Voraussetzungen kann ein voller Jupitertag in
einer Nacht von der Erde aus beobachtet werden.
Die Rotationsachse ist mit 3,1 Grad nur wenig geneigt. Gemessen an der Ebene
der Umlaufbahn ist die Achse der Erde deutlich schiefer (23,4 Grad). Die
hohe Rotationsgeschwindigkeit hat zur Folge, dass auf dem Planeten Jupiter
der Äquator nach außen gewölbt ist.
Aufbau
Jupiter ist ein Wasserstoffplanet. Der Äquatordurchmesser beträgt 143000
Kilometer. Im Zentrum befindet sich ein etwa 25.000 Kilometer großer Ge-
steinskern, der Temperaturen um 30.000 Grad hat.
Darauf folgt eine Schicht metal- lischen Wasserstoffes. Diese
sorgt mit der hohen Rotationsgeschwindigkeit für das starkausgeprägte Magnetfeld des
Planeten. lischen Wasserstoffes. Diese
sorgt mit der hohen Rotationsgeschwindigkeit für das starkausgeprägte Magnetfeld des
Planeten.
Der metallische Wasserstoff geht
über in einen breiten Gürtel aus
flüssigem Wasserstoff. Daran
schließt sich die Atmosphäre an.
Diese besteht zu 90 Prozent aus
Wasserstoff und zu fast 10% aus
Helium sowie Spuren von anderen Stoffen wie Ammoniak, Methan und Wasserdampf.
Die Ausmaße des Jupiter sind so gewaltig, dass die Erde 1300 mal dort
untergebracht werden könnte.
Besonders auffällig auf Jupiter sind der Große Rote Fleck, ein antizyklonischer Wirbelsturm, und zahlreiche weiße Ovale, die ebenfalls Sturmsysteme bilden.
Der Große Rote Fleck
Das Phänomen des großen roten Flecks ist auf fast jeder veröffentlichen
Fotografie von Jupiter zu sehen. Er ist der größte und langlebigste Sturm im
Sonnensystem. Genauer gesagt handelt es sich um einen antizyklischen
Wirbelsturm.
Er ragt mehr als acht Kilometer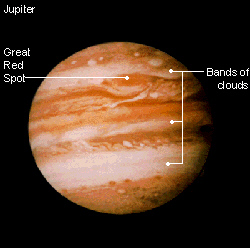 über die Wolkenschichten hin
aus. Seine Ausmaße sind wirklich enorm. Der Durchmesser
des großen roten Flecks übertrifft den der Erde dreimal.
über die Wolkenschichten hin
aus. Seine Ausmaße sind wirklich enorm. Der Durchmesser
des großen roten Flecks übertrifft den der Erde dreimal.
Der Supersturm wurde, freilich
ohne ihn als solchen deuten zu
können, schon vor 300 Jahren
entdeckt. Seitdem wurde er immer wieder gezeichnet und später auch fotografiert. Wie sich
zeigt, verändert er gelegentlich
seine Größe, aber er besteht seit
zumindest dieser Zeit.
Seine Färbung erhält er von Phosphor, der entsteht, wenn aufgewirbelte Gase
in der oberen Atmosphäre mit dem Sonnenlicht reagieren. Der große rote Fleck
dreht sich in etwa zehn Tagen einmal um sich selbst. Er wandert auch um den
Planeten herum. Dieses geschieht aber langsam und mit un-
regelmäßigen Geschwindigkeiten.
Warum kann sich dieser gewaltige Gewitter- und Wirbelsturm so lange halten?
Anders als auf der Erde, ist auf Jupiter für sofortigen Wolkenaustausch
gesorgt. Wolken auf der Erde entstehen langsam durch Wasserverdunstung.
Nachdem sie abgeregnet sind, braucht es seine Zeit, bis neue Wolken
entstehen können. Auf Jupiter fällt der Quasiregen in die heiße Atmosphäre
und wird sofort wieder verdampft.
Jupitermonde
Jupiter besitzt einen Ring und sechzehn Monde. Die vier größten werden nach
ihrem Entdecker als die galileischen Monde bezeichnet. Ihre Namen sind Io,
Europa, Ganymed und Kallisto.
Alle Monde liegen außerhalb des Jupiterringes. Die ersten am
Hauptring sind Adrastea und
Metis, danach folgen Amalthea
und Thebe. Nach den nun folgenden galileischen Monden
kommen Leda, Himalia, Lysithea
und Elara.
Jupiterringes. Die ersten am
Hauptring sind Adrastea und
Metis, danach folgen Amalthea
und Thebe. Nach den nun folgenden galileischen Monden
kommen Leda, Himalia, Lysithea
und Elara.
Die vier am weitesten von Jupiter entfernten Monde heißen
Ananke, Carme, Pasphae und
Sinope. Die letztgenannten
laufen entgegengesetzt um den
Planeten und dürften einge
fangene Asteroiden aus dem
Asteroidengürtel sein.
Sie kreisen um Jupiter in einer Entfernung von bis zu 24 Millionen
Kilometern. Während die vier galileischen Monde Ausmaße haben, die über den
Umfang unseres Mondes zum Teil hinausgehen, sind die anderen zwölf eher
klein. Keiner von ihnen ist größer als 200 Kilometer.
Die galileischen Monde sind auch aus anderen Gründen interessant. Io ist rot
und gelb gefärbt. Schwefel spuckende Vulkane verursachen diese Färbung. Io
ist dem Magnetfeld von Jupiter stark ausgesetzt. Daher rührt, dass zwischen
beiden starke elektrische Ströme fließen. Io hat die aktivste
Vulkantätigkeit im Sonnensystem. Sein Durchmesser liegt bei 3640 Kilometern,
seine Entfernung zu Jupiter bei 422000 Kilometern.
Europa zählt neben Io zu den jüngeren Monden. Am 20. Februar 1997 wurde
Europa von der Raumsonde Galileo fotografiert. Dabei stellte sich
Erstaunliches heraus. Der Mond hat einen Ozean, auf dem Eisberge schwimmen.
Flüssiges Wasser war außerhalb der Erde bislang für eher nicht
wahrscheinlich gehalten worden. Die Jugendlichkeit des Mondes wird durch die
geringe Anzahl von Meteoritenkratern bestätigt. Der Durchmesser beträgt 3140
km, die Entfernung zu Jupiter 671000 Kilometer.
Ganymed ist der größte Mond im Sonnensystem. Sein Durchmesser liegt mit 5262
Kilometern noch deutlich über dem des Merkur. Die Entfernung zu Jupiter
beträgt 1 070 000 Kilometer. Seine eisige Kruste ist voller Krater.
Der äußere der vier galileischen Monde ist Kallisto. Auch seine Oberfläche
ist vollständig mit Kratern überzogen. Der mächtigste von ihnen ist mit 300
Kilometern Walhalla. Um einmal den Jupiter zu umrunden, benötigt Kallisto
fast 17 Tage. Der Abstand beträgt rund 1,9 Millionen Kilometer. Der vierte
galileische Mond ist fast so groß wie Merkur (4800 Kilometer).
Erst 1980 wurde von der Raumfähre Voyager 1 entdeckt, dass Jupiter ein
Ringsystem besitzt. Der Hauptring hat eine Stärke von etwa 30 Kilometern.
50000 bis 58000 Kilometer oberhalb der Wolkendecke befindet sich das
lichtschwache Gebilde aus feinem Staub. Zur Wolkendecke hin erstreckt sich
ein noch feinerer Haloring.
©by megasystems
|
|
|